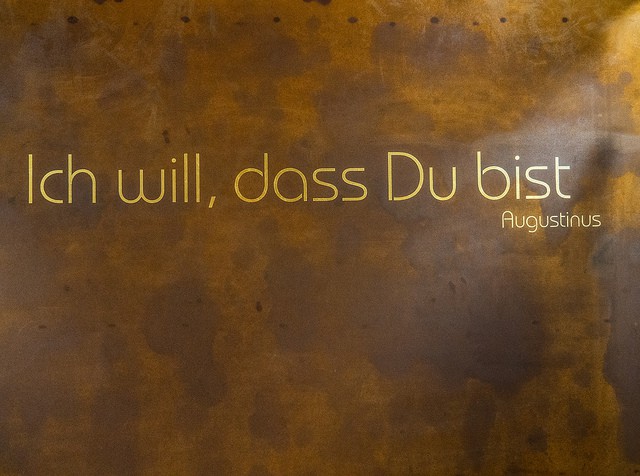Freitagabend: Köln Melanchthonakademie: Da wohnt ein Sehnen tief in uns
Moses weidet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters, er geht über die Steppe hinaus in die Wüste. Er bleibt stehen, er blickt zurück, er blickt nach vorne. Ich mache das gleiche. Ich blicke zurück. Wo komme ich her, wer bin ich? Ich bin glücklich, ich bin privilegiert, ich darf in Frieden und Sicherheit leben. Ich bin dankbar dafür. Ich bin geliebt, ich bin begleitet. Ich bin dankbar dafür. Ich blicke nach vorne: Worin liegt meine Sehnsucht? Ich will versuchen nachempfinden zu können, wie es Menschen geht, die meine Privilegien nicht haben, die sich am untersten Ende der Gesellschaft wiederfinden.
Samstag 10:00: Mein brennender Dornbusch heute in Köln
Suche deinen brennenden Dornbusch mitten in Köln, im Hier und Jetzt. Mit diesem Auftrag bin ich in Köln unterwegs – ohne Geld, nur mit fünf Not-Euros, ohne Telefon, ohne Plan, ohne Ziel. Wo finde ich die brennende Liebe Gottes in der Gegenwart? Wo ist sie für mich hier und heute spürbar und erfahrbar? Mose begegnet Gott in einem brennenden Dornbusch, nicht in einer großen Palme oder einer stolzen Eiche, er spricht aus einem brennenden Dornbusch zu Mose. In der Wüste ist es nichts Besonderes, dass ein Dornbusch brennt und doch begegnet Mose Gott genau in diesem normalsten aller Dinge. Wo kann ich heute in Köln Gott begegnen? Was nehme ich im Alltag wahr, dem ich keine besondere Beachtung schenke?
Samstagvormittag: Köln Chlodwigsplatz: Sei glücklich und frei, wir sind es auch.
Ich sitze auf einer runden Parkbank, in deren Mitte eine Eiche steht. Auf der anderen Seite sitzt eine Gruppe von fünf obdachlosen Männern. Ich beobachte, wie sie untereinander und wie andere Menschen mit ihnen umgehen. Kaum jemand nimmt von ihnen Notiz. Fast alle gehen vorbei, zu einem Termin, zum nächsten Meeting. Alle sind in Eile. Kaum jemand beachtet die Männer, kaum jemand begegnet ihnen, kaum jemand liebt sie. Und doch gehen sie miteinander unglaublich achtsam und liebevoll um. Sie teilen das Nichts, das sie haben, das wenige Essen, den Tabak, die Freude, das Leid, das Leben, das Bier und den Schnaps. Sie kümmern sich umeinander. Sie lachen viel. Es scheint ihnen an nichts zu fehlen. Sie betteln nicht.
Nur zwei Kinder nehmen die Männer richtig wahr. Ein Mädchen fragt seinen Vater: „Geht es dem Mann da gut?“ Ein Junge fragt seine Mutter: „Mutti, was machen die Männer hier?“ Ja, was machen die Männer hier? „Was machst du hier? Schau nicht so ernst und nachdenklich!“, sagt einer der Männer zu mir, „wir sind glücklich und frei, sei du es auch.“ Glücklich und frei sein, wenn man außer den anderen, die auch nichts haben nichts hat, wenn man den Tag nur zugedröhnt aushält, wenn man keinen Ort hat, der Zuhause ist.
Samstagmittag: Köln U-Bahnstation Chlodwigsplatz – „Dio non c’è!“ – der erste Soundtrack – mein Sakrament
Mich zieht es in die U-Bahnstation am Chlodwigsplatz. Warum, weiß ich nicht. Am Abend erfahre ich es: „Straßenexerzitien sind Chefsache“, sagt einer der Begleiter zu mir. Ich fahre die erste Rolltreppe nach unten. Niemand da. Es ist gespenstig. Ich fahre die zweite Rolltreppe nach unten. Bis auf einen Mann in roter Jacke ist der Bahnsteig leer. Er blickt mich mit traurigen Augen an und fragt: „Hast du ein paar Münzen für mich? Ich muss mir was zu essen kaufen.“ – „Ich habe kein Geld dabei, aber ich habe Zeit für dich.“ Giovanni nimmt die Einladung an. Er erzählt mir von seinem Leben, von seinem Glauben, er erzählt mir seine Geschichte. Ich höre zu. Das Leben ist kontingent. Es könnte anders sein, es kann anders sein, es wird anders sein. Giovanni kommt ursprünglich aus Rom. Bis vor kurzem hatte er ein normales Leben. Seinen Job hat er durch seine Krankheit verloren. Seine Wohnung hat ihm das Amt weggenommen. Er hat nichts mehr außer seinem blauen Rucksack. Er spielt mir ein Lied vor: „Dio non c’è!“ – Gott ist nicht da.
Ich kann kein Italienisch. Ich verstehe kein Wort. Es wird zum Sakrament für mich. Leonardo Boff hat den Zigarettenstummel seines Vaters. Ich habe „Dio non c’è!“ Das Lied bringt mich sofort zurück nach Köln, in die Südstadt, an den Chlodwigplatz. Giovanni aber glaubt, dass Gott da ist. Er hat durch den Tod seines Vaters neu zum Glauben gefunden. Eines Tages in Rom: 07:09 Uhr – Giovanni hört im Schlaf die Stimme seines Vaters: „Giovanni ich brauche dich.“ Sein Vater ist 500 Kilometer weit weg auf der Intensivstation, er stirbt gerade. Giovanni sitzt vor einem Bild seines Vaters. Er spürt eine Umarmung. Er fühlt sich geborgen und getragen. Er betet zum ersten Mal seit vielen Jahren. Einige Jahre später zieht er nach Köln. Dort engagiert er sich in der Obdachlosenseelsorge, er hilft beim Kaffeenachmittag, besucht regelmäßig den Gottesdienst, geht zur Meditation und zum Bibelgespräch. Das Leben ist Ironie: Jetzt, nur ein paar Jahre später geht er als obdachloser Mann zur Obdachlosenseelsorge. Das Leben ist Ironie: Giovanni bettelt in der U-Bahnstation einer Linie, mit der kaum wer fährt. Sie hat nur wenige Stationen und führt nirgends hin. Das Leben ist schön. Giovanni verabschiedet sich von mir mit dem schönsten Lächeln im Gesicht, das ich je gesehen habe. „Danke, dass du von Mensch zu Mensch zu mir gesprochen hast, das hat schon lange niemand mehr.“
Samstag 16:00: Severinstraße. Kommst du eh zurecht?
Eine Frau spricht mich an: „Darf ich dich was fragen?“ – „Du darfst mich alles fragen.“ Sie erzählt mir die Geschichte ihres Lebens. „Entschuldige, dass ich dich angesprochen habe, aber du hast so lieb geguckt.“ – Wusste ich gar nicht… Sie fragt mich um Geld, damit sie sich für 18€ in der Obdachlosenhilfe einen Schlafsack und eine Isomatte kaufen kann. Ich gebe ihr meine fünf Not-Euro. Sie fragt mich, ob ich mir sicher bin, dass ich ihr das Geld geben will und ob ich zurechtkomme, wenn ich es ihr gebe. Sie umarmt mich und sagt: „Danke, dass du so lieb mit mir geredet hast.“
Sonntag 10:00: Zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden
Ich sitze am Chlodwigplatz an der gleichen Stelle, an der ich tags zuvor die Gruppe obdachloser Männer beobachtet habe. Ich mache einen Perspektivenwechsel und setzte mich auf die Stelle, an der die Männer gesessen haben. Ich ziehe zuerst meine inneren Schuhe aus. Ziehe alles aus, was mich distanziert macht, was mich schützt, womit ich anderen wehtue, wenn ich ihnen auf die Füße trete. Ich mache mich angreifbar, exponiere mich selbst. Ich ziehe tatsächlich meine Schuhe aus, nehme alles anders wahr und versuche mich noch mehr in die obdachlosen Männer hineinzuversetzen. Es gelingt mir nicht wirklich.
Sonntagabend: Chlodwigplatz – Die besten Pommes der Stadt – ein ganz besonderes Abendessen
Ich will zu Abend essen. Ich will nicht alleine zu Abend essen. Ich frage einen Mann, der am Boden sitzt und um Geld bettelt, ob er schon zu Abend gegessen hat und ob ich ihn zum Essen einladen darf. „Ich habe schon was gegessen, ist aber schon etwas her“, antwortet Dirk. Er sagt mir, wo es die besten Pommes gibt, ich hole zwei kleine Portionen und frage ihn, ob ich mich neben ihn hinsetzten darf. – „Klar, wenn‘s dir nicht zu kalt ist.“ Perspektivenwechsel nochmal anders. Den Leuten, die vorbeigehen auf die Schuhe schauen. Dirk isst wenig und langsam. Er hat‘s mit dem Magen. Er muss seit acht Jahren zur Dialyse, seine Nieren machen schlapp. Ich habe meine Portion Pommes aufgegessen. Er fragt mich, ob ich was von seinen mag. Kaum jemand nimmt uns wahr. Ich sitze zwei Stunden neben ihm am Boden. Ergebnis: Null Cent. Kaum ein Blick. Kein Lächeln. Eine Mango – „Mango hatte ich noch nie, wie isst man die?“
Dirk verurteilt niemanden der ihm nichts gibt. „Ich weiß ja nicht wie es ihnen geht. Wenn mir wer was geben will, bin ich froh und dankbar, ich bitte sie aber nicht darum. Die Leute können sich schon denken, warum ich hier unten sitz. Aber ich bin keinem böse, der mir nichts gibt.“ Nach zwei Stunden, in denen wir am Boden sitzen, er mir erklärt, dass er Poldi‘s Döner nicht mag, weil das Fleisch zu trocken ist und es die Saucen auch nicht bringen, er sich darüber aufregt, dass es in ganz Köln nur zwei Obdachloseneinrichtungen speziell für Frauen gibt und er mir erzählt, dass seine einzige Angst darin besteht auf der Straße zu sterben und wie Abfall weggetragen zu werden verabschieden wir uns. Er fragt mich, ob ich einen Platz zum Schlafen habe oder ob er sich darum kümmern soll. Tief berührt bedanke ich mich für sein Angebot, erkläre ihm, dass ich einen Schlafplatz habe und wünsche ihm alles Gute. Ich bedanke mich bei ihm und bei Gott für dieses ganz besondere Abendessen.