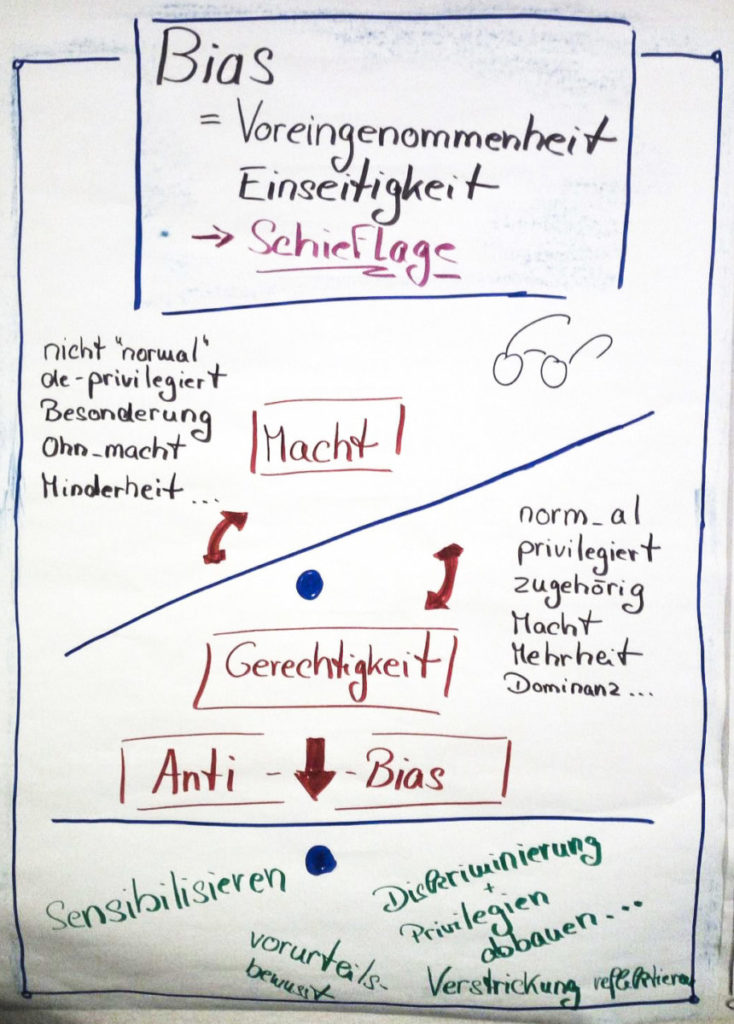Im folgenden Artikel reflektiert Klaus Mertes, Begleiter von Straßenexerzitien und Rektor des Kollegs von St. Blasien, die biblischen Berichte der Mähler Jesu, und die Erfahrungen, die Exerzitanden bei Straßenexerzitien machen durften.
Klaus Mertes SJ*
1. Vor- und nachösterliches Mahl
Das lukanische Geschichtswerk, bestehend aus Lukasevangelium
und Apostelgeschichte, ist in der Mitte durch eine redaktioneller
Zwischenbemerkung geteilt (Apg 1,1-3), an die Apg 1,4 anschließt: „Und da er mit (ihnen) speiste, gebot er ihnen
…“ Die Begegnungen mit dem Auferstandenen sind signifikant mit einem
gemeinsamen Mahl verbunden. Das bestätigt auch rückblickend der
Auferstehungszeuge Petrus, der für „uns“ spricht, „die wir mit ihm zusammen
gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung von den Toten.“ (Apg
10,41) Damit ist auch die erzählerische Kontinuität zum Schluss des ersten Teils
des lukanischen Geschichtswerkes hergestellt. Zweimal erscheint der Auferstandene
dort den Seinen in Verbindung mit Mahlzeiten. In Emmaus: „Und es geschah, als
er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und
gab es ihnen.“ (Lk 24,28.30). In Jerusalem: „Sie gaben ihm ein Stück gebratenen
Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen.“ (Lk 24,42f)
Die Verbindung von österlicher Erscheinung und gemeinsamem
Mahl fällt in den Berichten von Lukas besonders auf. In den beiden anderen
synoptischen Evangelien werden die nachösterlichen Mahlzeiten nicht hervorgehoben;
dafür umso mehr, wie im Übrigen auch bei Lukas, das letzte Abendmahl vor der
Hinrichtung Jesu. Immerhin heißt es in dem sekundären Abschluss des
Markusevangeliums: „Später erschien er den Elf, als sie bei Tisch waren.“ (Mk
16,14) Im Johannesevangelium sind zwar nicht alle Erscheinungen des
Auferstandenen mit Mahlzeiten verbunden, aber doch ganz markant im
Schlusskapitel: „Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst … Jesus trat heran,
nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.“ (Joh 21,12f)
Der Auferstandene erscheint den Seinen also vornehmlich bei
Mahlzeiten. Mit der Eucharistiefeier als dem „letzten Abendmahl“ Jesu steht
allerdings nicht ein nachösterliches, sondern ein vorösterliches Mahl im
Mittelpunkt der Vergegenwärtigung des Auferstandenen. Das ist kein Gegensatz.
Im Gegenteil: Die Kontinuität zwischen der Mahlpraxis des vorösterlichen und
des nachösterlichen Jesus wird auf diese Weise greifbar. Ohne Ostern keine
Eucharistie. Ohne Eucharistie kein Ostern. Einerseits verbindet die Eucharistie
die Gemeinde mit der vorösterlichen Geschichte Jesu, besonders mit dem Vorabend
seiner Kreuzigung. Andererseits sind bereits die Berichte der synoptischen Evangelien
aus der österlichen Perspektive verfasst; sie spiegeln den Glauben der Autoren
und ihrer Gemeinden vor dem Hintergrund ihrer Begegnungen mit dem
Auferstandenen wieder. Die Verschränkung zwischen vor- und nachösterlicher
Präsenz Jesu ist also gerade in der Eucharistiefeier unauflösbar.
So wird es auch möglich, die Praxis der nachösterlichen Eucharistie durch die Osterberichte durchschimmern zu sehen. Neutestamentler sprechen „von dem eucharistischen Rahmen …, der die Offenbarung des Auferstandenen an die Emmausjünger umgibt.“[1] Vergleichbares gilt für andere nachösterliche Mahlzeiten mit dem Auferstandenen. Die zeitliche Situierung der Tiberias-Szene (Joh 21,12f) in der frühen Morgenstunde lässt sich „vom Brauch der Christen her“ verstehen, „ihr kultisches Mahl am Sonntag in der Morgenfrühe zu halten.“ Und weiter: „Jesus … hat für sie (die Jünger) die lebendig machende Gabe der Eucharistie bereit. Die Jünger tragen dazu bei durch die von ihnen gefangenen Fische.“[2]
2. Die Fußwaschung
Dass nicht alle Getauften heute gemeinsam Eucharistie feiern
können, gehört zu den Nöten der getrennten Christenheit. Es gibt heute keine
geeinte, über den ganzen Erdkreis verteilte „katholische“ Christenheit, solange
die Mahlgemeinschaft der Getauften untereinander und mit dem Auferstandenen –
aus welchen Gründen auch immer – nicht in vollem Umfang besteht. Das gilt
jedenfalls dann, wenn man, wie das Zweite Vatikanische Konzil es tut, die
Eucharistie als „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“[3]
versteht. In dieser Situation erhalten einige Besonderheiten in den Mahl-Berichten
der Evangelien zunächst praktische Bedeutung, die den Stillstand der Trennung
unterlaufen: Sie enthalten Perspektiven für eine vorliturgische Praxis mit
Bezug auf die Mahlpraxis Jesu mitten in der Trennungssituation.
Eine solche Besonderheit bietet bekanntlich der johanneische
Bericht über das letzte Mahl Jesu vor seinem Tod. „Es fand ein Mahl statt“ (Joh
13,1), bei dem Jesus den Anwesenden die Füße wäscht. „Johannes berichtet von der
Fußwaschung an der Stelle, an der in den anderen Evangelien von der Einsetzung
der Eucharistie berichtet worden war. In diesem Sinne schildert uns Johannes
bewusst oder unbewusst die Innenseite der Eucharistie. Wo Christen sich zum
Mahl Jesu versammeln, kann dies nur in der Weise und in der Gesinnung
geschehen, in der Jesus in sein Leiden hineinging: in Liebe und
Dienstbereitschaft.“[4]
Welche geistliche Kraft von der Geste der Fußwaschung
ausgeht, beschreibt jüngst Emmanuel Carrère in seinem Roman über den
Evangelisten Lukas.[5] Eine Brieffreundin hatte
ihn, der mit seinem Verlust des christlichen Glaubens ringt, zum Besuch von
Einkehrtagen in der Arche von Jean Vanier angeregt:[6] „Ich
will Ihnen eine Lösung vorschlagen. Sie ist durchaus greifbar. Konkret befindet
sie sich in einer Schüssel, in der jemand Ihnen die Füße wäscht und Sie die
eines anderen waschen, am besten die eines Behinderten.“ Carrère findet sich nun
„mit etwa vierzig, in Siebenergruppen aufgeteilten Christen in einem Raum eines
restaurierten Bauerhofs unter einem Kruzifix und – guck mal einer an – einer
großen Reproduktion von Rembrandts Verlorenem
Sohn wieder.“ Er beschreibt auf anrührende Weise die Zusammensetzung der
Gruppe, lässt den geistlichen Weg des Arche-Gründers Revue passieren, geht auf
die Fußwaschungsszene im Johannesevangelium ein[7] und
referiert die Ansprache von Jean Vanier[8]. Dann
kommt die Fußwaschung. „Wir ziehen uns die Schuhe und Strümpfe aus und krempeln
die Hosenbeine auf. Der Personalchef beginnt. Er kniet vor dem Schuldirektor
nieder, gießt aus dem Krug lauwarmes Wasser über seine Füße und rubbelt sie
vorsichtig ab – zehn Sekunden, zwanzig, es dauert ziemlich lang, und ich habe
den Eindruck, dass er gegen die Versuchung ankämpft, zu schnell vorzugehen und
das Ritual auf etwas rein Symbolisches zu reduzieren. Den einen Fuß, den
anderen Fuß, dann trocknet er ihn mit einem Handtuch ab. Dann ist der
Schuldirektor an der Reihe, und er kniet vor mir nieder und wäscht mir die
Füße, bevor ich die der Caritas-Funktionärin wasche. Es ist wirklich sehr
seltsam, Unbekannten die Füße zu waschen. Ein schöner Satz von Emanuel Levinas
fällt mit ein, den Bérengère (die Brieffreundin – KM) in einer Mail zitiert
hat: über das menschliche Gesicht, das es einem verbietet zu töten, sobald man
es sieht. Sie sagte: Ja, das stimmt,
aber auf die Füße trifft es noch mehr zu, Füße sind noch bedürftiger, noch
verletzlicher, tatsächlich sind sie das Verletzlichste, das Kind in jedem von
uns. Und obwohl ich es etwas peinlich finde, finde ich es auch schön, dass
Leute zu diesem Zweck zusammenkommen, um dem so nahe wie möglich zu sein, was
das Bedürftigste und Verletzlichste in der Welt und in ihnen selbst ist. Das
ist Christentum, sage ich mir.“
Die Umsetzung der johanneischen Fußwaschungsszene vermag
einige Probleme zu umgehen, die die gegenwärtige Praxis der Eucharistie –
jedenfalls in der katholischen und orthodoxen Variante – nicht zu lösen vermag.
Zum einen setzt die Teilnahme an der Fußwaschung kein ausdrückliches
Glaubensbekenntnis voraus. Die Geste darf ohne Einschränkung zweifelnde,
zögernde und suchende Personen, noch- oder nicht-mehr-dazugehörende,
wiederverheiratet geschiedene, evangelische, katholische, orthodoxe und anderen
Personen einbeziehen.
Zum anderen wird im Vollzug der Fußwaschung die missionarische Bedeutung von Liturgie sichtbar. Dafür gibt es auch andere neutestamentliche Zeugnisse. Von Paulus ist zum Beispiel die Erinnerung an eine Gottesdienst-Situation der Urgemeinde erhalten, bei der offensichtlich vorausgesetzt ist, dass auch „Unkundige und Ungläubige“ Zugang haben, und die im Vollzug eine missionarische Wirkung entfaltet. Konkret geht es Paulus in der betreffenden Passage (1 Kor 14) darum, den Vorrang der verständlichen prophetischen Rede vor der unverständlichen Zungenrede aufzuweisen. Er tut dies mit dem Argument, dass die prophetische Rede im Unterschied zur Zungenrede für die hinzutretende unkundige Person verständlich ist. Sie bewirkt, dass die von außen Hinzutretenden auf „ihr Antlitz fallen, Gott anbeten und offen bekennen: Gott ist wirklich unter Euch.“ (1 Kor 14,25) Ähnlich erscheint in Carrères Bericht die Wirkung der Fußwaschung auf ihn als teilnehmenden Ungläubigen zu sein: „Das ist Christentum, sage ich mir.“ Zwar beendet er seinen Bericht mit einer Einschränkung: „Trotzdem möchte ich nicht von der Gnade berührt werden, und, nur weil ich die Füße gewaschen habe, bekehrt nach Hause zurückkommen wie vierundzwanzig Jahre zuvor. Zum Glück passiert nichts dergleichen.“ Dennoch: Es hätte passieren können, vielleicht gerade deswegen, weil die Feier der Fußwaschung absichtslos war, ganz auf die Gegenwart Christi hin ausgerichtet, und darum umso kraftvoller in der Wirkung.
3. Mähler auf der Straße
Noch ein anderer Aspekt des johanneischen Berichts gibt zu
denken: Das vorösterliche „Mahl“, das Jesus am Abend vor seiner Hinrichtung
feiert, ist nicht das Paschamahl, von dem die Synoptiker berichten: „Freilich gibt
es bei Johannes keinen Hinweis darauf, dass es sich um ein Paschamahl gehandelt
haben könnte. Die Motive eines solchen Mahles erscheinen bei dem Paschafest,
das Jesus mit seinen Jüngern feiert, in Joh 6,51c-58. Dort ist das Paschafest
offenbar schon verchristlicht“[9] Und auch das ist wiederum bezeichnend für den
Erzählstil des Johannesevangelisten: Er bezieht die ausführliche Pascha-Erinnerung
souverän auf eine nicht-kultische Situation, auf die wunderbare Brotvermehrung
(Joh 6,1-15). Das Mahl am See Tiberias findet zwar zeitlich nahe zum Pascha
statt (vgl. Joh 6,4), ist aber selbst – noch offensichtlicher als „das Mahl“ in Joh 13,1 – kein
Paschamahl. Vielmehr wird eine große Menschenmenge unter freiem Himmel gesättigt,
sozusagen auf der Straße, d.h. ohne Vorordnung einer Arkandisziplin, die in
diesem Falle ja auch nicht situationsgerecht wäre, genauso wenig wie bei den
nachösterlichen Mählern. Im Umkehrschluss wird man deswegen auch sagen müssen,
dass die vorösterliche Mahlpraxis Jesu, wie sie die Synoptiker berichten, ebenfalls,
beginnend mit den Mählern mit „Zöllner und Sündern“ in Kafarnaum, in die
Erinnerung und Gestalt der nachösterlichen Mähler mit dem Auferstandenen
einfließt und einfließen soll, und nicht nur der „eucharistische Rahmen“ (s.o.)
des Paschamahles am Abend vor der Hinrichtung Jesu. Das wird auch in den
einschlägigen Texten von Paulus deutlich. Denn die nachösterliche Praxis kannte
offensichtlich beides: Die Eucharistie (1 Kor 11,17ff) mit den Einsetzungsworten
sowie die mit dem Kiddusch eingeleitete Hausfeier (1 Kor 10.7ff).[10]
Doch damit nicht genug. Die Exegese neigt aktuell dazu, die
johanneischen Berichte auch historisch wieder ernster zu nehmen.[11] Josef
Ratzinger/Benedikt XVI erwägt, den Bericht in Joh 13,1, was die zeitliche
Situierung betrifft, für historisch glaubwürdiger zu halten als die der
Synoptiker. Das führt ihn zu Frage nach der Gestalt des Mahles: „Aber was war
Jesu Letztes Mahl dann eigentlich? Und wie kam es zu der gewiss sehr frühen Auffassung
von seinem bevorstehenden Pascha-Charakter? Die Antwort von Meier ist
verblüffend einfach und in vieler Hinsicht überzeugend: Jesus wusste von seinem
bevorstehenden Tod. Er wusste, dass er das Pascha nicht mehr werde essen
können. In diesem vollen Wissen lud er die Seinen zu einem Letzten Mahl ganz
besonderer Art ein, das keinem bestimmten Ritus zugehörte, sondern sein
Abschied war, in dem er Neues gab, sich selbst als das wahre Lamm schenkte und
damit sein Pascha stiftete.“[12]
Praktische Relevanz jedenfalls erhalten diese Beobachtungen
vor dem Hintergrund von „Eucharistien auf der Straße“, wie sie von Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der in den letzten Jahren entstandenen „Exerzitien auf der
Straße“[13]
berichtet werden. Es handelt sich um österliche Erfahrungen, die über die
Strukturähnlichkeit mit den nachösterlichen Mählern eine Brücke zur Eucharistie
bilden. Also: „Eucharistien auf der Straße“.
Eine Exerzitantin berichtet: „Mein Lieblingsplatz ist besetzt. Zwei Kinder und ihr Hund sind auf dem Heimweg vom Elbstrand und legen eine Pause ein. Das Mädchen, vielleicht fünf Jahre alt, wird meine Retterin, indem sie einfach fragt: Willst du dich zu uns setzten? Ja, ich will. Ich setze mich, wir unterhalten uns, wir spielen Kronenkorkenverstecken, es wird dunkel. Eine ältere Frau kommt von ihrer Putzstelle und bietet uns von den Brötchen an, die sie hat mit nach Hause nehmen dürfen. Es wird ein kleines Abendmahl. Ich gehöre dazu. Und ich bin dankbar.“[14] Oder: Ein Exerzitant trifft in Berlin auf dem Tempelhofer Feld im Winter eine Gruppe von „äußerlich etwas verwahrlosten Männern“, die an einem großen Iglu bauen. „Interessiert fragte ich, wie lange sie für dieses riesige Teil gebraucht hätten. Wenn du mithilfst, werden wir fertig, bevor alles wieder schmilzt. … Also setzte ich meinen Rucksack ab, zog meine Handschuhe aus und schleppte jede Menge Schnee an, damit das Iglu dicker wurde und möglichst lange halten konnte. Niemand fragte mich, wer ich sei und was ich hier mache. Als wir eine Pause machten, wurde ich eingeladen, mit ins Iglu zu kommen. Ich staunte nicht schlecht als ich sah, dass Platz für vier Plastikstühle und einen kleinen Tisch im Innenraum war. Auf einem der Stühle nahm ich Platz. Ein Mann hatte eine Thermoskanne mit heißem Kaffee dabei. Jeder durfte einen Schluck aus dem Deckel der Kanne trinken. Ich packte meine Mandelhörnchen aus, die ich eigentlich für mich gekauft hatte, und teilte es unter uns auf. Die Augen der Männer glänzten.“[15] Oder: Eine Exerzitantin lernt auf der Straße Willy kennen, einen obdachlosen Mann. Aus der ersten zufälligen Begegnung werden im Laufe der Tage mehrere Wiedersehen und zum Schluss eine Abschiedsbegegnung. „Er strahlte und sagte: Ja was, die Elisabeth ist wieder da. Er sagte nicht wie beim allerersten Mal: Darf ich Dame zu einem Glas Wein einladen? Sondern: Wo lassen wir uns nieder? Ich schlug vor: Beim Italiener im Hinterhof war es doch sehr gemütlich. Da hatten wir nämlich schon mal über Mittag gesessen. Als nichts wie hin. Willy mit seinem aufgebockten Rollator mit Unterarmgehhilfe. Er nennt ihn Hundeschlitten. Als wir in der Pizzeria angekommen sind, wird eingeparkt, wir setzen uns an denselben Tisch wie beim letzten Mal und sind mit den BASF-Angestellten im schicken Anzug oder Minirock in bester Gesellschaft. Ich bemerke, dass Willy etwas mehr Zeit braucht als sonst, und vermute, dass er noch einen Schluck aus seiner Eierlikörflasche nehmen will wie sonst auch. Aber so ist es nicht. Willy holt aus seiner blauen Sporttasche eine Plastiktüte heraus und legt sie auf den Tisch. Ich kann nicht sofort erkennen, was darin ist, ein Pfirsisch vermutlich. Stimmt aber wieder nicht. Er holt aus der Tüte eine frische, große, violettfarbene Feige heraus, teilt sie mit dem rechten Daumennagel, reicht mir die eine Hälfte und steckt sich die andere in seinen Mund, in dem keine Zähne mehr sind. Dabei schaut er mir über den Rand seiner Brill tief in die Augen und sagt kein Wort. Das braucht es auch nicht. Die Geste genügt … Heute Abend habe ich verstanden, was Eucharistie heißt: Das Leben miteinander feiern, weil Gotten mitten da ist.“[16]
4. Konsequenzen
Ähnlich wie bei der Fußwaschung verhält es sich mit den
Eucharistien auf der Straße: Die Teilnahme setzt zunächst einmal nicht mehr
voraus als eine grundlegende Sehnsucht nach geistlicher Erfahrung im Rahmen der
erzählerischen Vorgaben der biblischen Tradition. Wie die Fußwaschung vermögen
die Erfahrungen auf der Straße eine missionarische Wirkung zu entfalten, gerade
für diejenige Personen, die sich von der Einladung der Straße überraschen
lassen und sie annehmen. Doch was bedeuten solche niedrigschwelligen Mahl-Erfahrungen,
solche eucharistischen Begegnungen für die Feier der Eucharistie in ihrer
kirchlichen, durch Arkandisziplin geschützten Form?
Zunächst: Arkandisziplin hat sinnvollerweise eine
markierende Funktion, um den Bereich der sakralen Handlungen von dem der
profanen Handlungen zu unterscheiden; sie hat eine mystagogische Funktion, um
schrittweise in die Fülle der Liturgie einzuführen; sie hat eine schützende
Funktion, um solche Personen fernzuhalten, die „kein Hochzeitsgewand anhaben“
(vgl. Mt 22,11). Und es ist für die Kirche ein unhintergehbares Faktum, dass
sich alle Berichte über vor- und nachösterliche Mahlfeiern Jesu bündeln in der
Feier des einen Abendmahles am Abend vor seinem Leiden und Sterben. So wird im
Rückblick ausdrücklich das Brechen des Brotes mit der Treue Jesu zu seiner
Sendung bis in den Tod hinein verbunden: „Vater, in deine Hände lege ich meinem
Geist.“ (Lk 23,46) Dieser Zusammenhang
macht dann auch die Eucharistiefeier tatsächlich zu „Quelle und
Höhepunkt des christlichen Lebens“. Das gilt es zu bewahren.
Doch „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ ist
nicht einfach ein abgrenzender, sondern vor allem auch ein hinweisender
Begriff. Die Eucharistie weist über sich selbst hinaus. Sie hat ihren Ursprung
von der Straße des Lebens her. Ohne den ganzen Weg, den Jesus gegangen ist,
gäbe es die Eucharistie nicht. Und sie endet mit der Sendung nach draußen, auf
die Straße, um den Auferstandenen im Leben zu entdecken – und auch da
eucharistisch, also dankend seine Hingabe anzunehmen, wie sie sich eben auf der
Straße des Lebens ereignet.
Das hat mehrere praktische Konsequenzen: Keine noch so
sinnvolle Arkandisziplin kann den Zugang zu dem Auferstandenen vollkommen
versperren, gerade auch nicht zur eucharistischen Begegnung mit ihm. Mehr noch:
Es kann nicht das Ziel einer sinnvollen Arkandisziplin sein, absolute Zugangssperren
einzubauen. Denn gerade auf der Straße des Lebens achtet der Auferstandene nicht
auf Zugangsbeschränkungen zu sich selbst, genauso wenig wie Jesus vorösterlich
die Sünder am Katzentisch Platz nehmen ließ. Der Gott der Überraschungen lässt
sich nicht auf eine Feier beschränken, zu deren Selbstverständnis es gehört, vor
Überraschungen so gesichert wie möglich zu sein, gerade auch gesichert vor dem „Fremden“
(vgl. Lk 24,18), dem die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus begegneten.
Die alttestamentliche Kultkritik konnte im Verhältnis zu den höchsten liturgischen Feierlichkeiten Israels scharf formulieren: „Bringt mir nicht länger sinnlose Gaben dar, sie sind für mich widerliches Räucherwerk. Neumond und Sabbat – ich ertrage nicht eure schändlichen Feste.“ (Jes 1,13) Aus einer total abgesicherten Eucharistie entweicht das Leben. Dem in Brot und Wein hingegebenen Jesus wird quasi die Luft zum Atmen/Beatmen genommen. Das wird zwar niemals ganz gelingen, aber zugleich ist es eine ernste Frage an die Praxis der Ausgrenzung. In der eucharistischen Begegnung auf der Straße gibt es diese Ausgrenzung von Seiten des Auferstandenen her nicht. Darin ist er vielmehr ganz derselbe wie der Jesus, der seinen Gästen und Jüngern vorösterlich das Brot brach, und der das Brot als bleibendes Medium seiner Präsenz nach seinem Tod[17] erwählte.
* Der Artikel erschien zuerst in Stimmen der Zeit, Heft 4, 2020
[1] Francois Bovon, Das
Evangelium nach Lukas, EKK III/4, Düsseldorf 2009, S.563
[2] Johannes Beutler, Das
Johannesevangelium, Kommentar, Freiburg 2013, S. 547f
[3] Lumen Gentium 11, dazu
auch: Katechismus der katholischen Kirche, Nr.1324-1326
[4] Ebd, S. 384
[5] Emmanuel Carrère, Das
Reich Gottes, Berlin 2017
[6] Ebd., S.496-506
[7] „Das wichtigste Sakrament
des Christentums hätte auch die Fußwaschung werden können statt die
Eucharistie.“ S.503
[8] Wenn Jesus „die
Eucharistie einführt, spricht er zu allen zwölf Jüngern als Gruppe. Doch wenn
er niederkniet, um die Füße zu waschen, dann kniet er vor jedem Einzelnen
nieder …“ S.504
[9] Ebd, S. 376f / „Brot vom
Himmel“: Einen neuer Hinweis zur eucharistischen Relevanz der vorösterlichen
Mahlpraxis Jesu stammt von Eckhard Nordhofen (Corpora. Die anarchische Kraft
des Monotheismus. Freiburg 2018). Er weist darauf hin, dass die Brot-Bitte Jesu
im Vaterunser auf das eucharistische Brot bezogen werden sollte. Sein Argument
lautet, dass der Schlüsselkonflikt zwischen Jesus und den Schriftgelehrten um
die Frage nach dem Medium der Gottesgegenwart kreist. Für die „Schriftler“
(Nordhofen) ist es die Schrift, für Jesus ist es der „Menschensohn“. Das Wort
Gottes ist Fleisch geworden (vgl. Joh 1,14). Bereits vorösterlich ergibt sich
daraus die Frage, in welchem Medium Jesus selbst seine bleibende Gegenwart nach
seinem Tode sieht. Diese kann ja nicht wieder durch die Schrift gegeben sein,
auch nicht eine Schrift über ihn. So kommt bereits vorösterlich das Brot als
Medium ins Spiel, wie das Vaterunser, welches das Gebet Jesu ist, zeigt. „Unser
himmlisches (überwesentliches) Brot gib uns täglich.“
[10] Vgl. Norbert Baumert, Die
Sorgen des Seelsorgers, Übersetzung und Auslegung des Ersten Korintherbriefs,
Würzburg 2007, S.145 ff. Baumert
unterscheidet zwischen „Brechen des Brotes“ (Kidusch) und „Mahl des Herrn“
(Eucharistie) als zwei unterschiedlichen Mählern. In 1 Kor 10 ist vorausgesetzt, dass man durch
die Taufe bereits Gemeinschaft untereinander ist, und nicht erst durch das
Essen des Brotes in Gemeinschaft mit Christus tritt. „Leib Christi“ ist in 1
Kor 10 wäre also ekklesiologisch zu verstehen.
[11] Anderes Beispiel: Die
Vorverlegung des Vorfalls im Tempels an den Anfang der Erzählung vom
öffentlichen Auftritt Jesu (Joh 2,13-22), vgl. dazu: Alber Nolan, Jesus vor dem
Christentum, Luzern 1993, S.142-148.
[12] Benedikt XVI, Jesus von
Nazareth II, Freiburg 2011, S.133
[13] Christian Herwartz u.a.,
Im Alltag der Straße Gottes Spuren suchen, Persönliche Begegnungen in
Straßenexerzitien, Neukirchen 2016
[14] Ebd., S.52f
[15] Ebd., S.66f
[16] Ebd., S.85f
[17] Vgl. Eckhard Nordhofen,
aaO, 229-263